Führung in Bamberg „Wasser als Lebenselixier des Klosters“ kam gut an
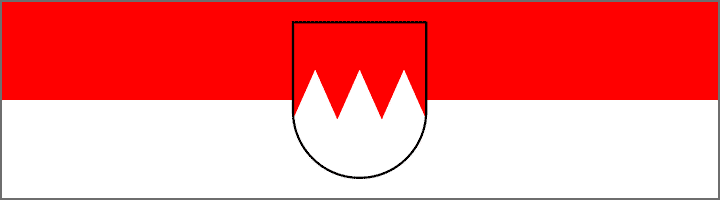
Auf reges Interesse stieß die Führung „Wasser als Lebenselixier des Klosters“, zu der der Verein „Bewahrt die Bergstadt“ eingeladen hatte. Rund 60 Interessierte folgten den Ausführungen der Stadtheimatpflegerin Stephanie Eißing M.A., die im Klosterhof von St. Michael erläuterte, wie das Kloster den hohen Wasserbedarf zu decken verstand. Schließlich stellte es einen großen Wirtschaftsbetrieb dar, der viele Menschen zu versorgen hatte. Küche, Brauerei, und die dazugehörige Haltung von Arbeitstieren, die Pferdetränke, Feuerlöschteich und Wäscherei, aber auch der Brunnen im Kreuzgang und im Hof sowie die Abteigärten waren auf eine sichere Wasserversorgung angewiesen.
- Brunnenzugang im Wald
- Eingang zur Brunnenstube
- Merkurbrunnen am Michelsberg
Da sie durch gegrabene Brunnen nicht zu decken war, verlegte man schon im 11. Jahrhundert eine Holzrohrleitung und 1130 unter Bischof Otto I., eine aus Bleirohren zu einer Quelle im Michelsberger Wald. Den Aufzeichnungen des Klosters lassen sich in der Folge laufende Reparatur- und Verbesserungsmaßnahmen entnehmen, bis die Leitung um 1970 durch eine aus PVC ersetzt wurde. Sie ist aber immer noch funktionstüchtig und versorgt den unterirdischen Löschwasserbehälter und den Merkurbrunnen im Hof mit ca. 7000 m³ im Jahr.
Das Wasser entspringt einer Brunnenstube im Wald, die etwa 30m in den Fels getrieben ist. Das Immobilienmanagement hatte freundlicherweise den Zugang zu dem Stollen ermöglicht, so dass man einen Eindruck von der Bauleistung der damaligen Arbeiter gewinnen konnte.
Auf dem Weg der Leitungstrasse von St. Michael durch die Klosterlandschaft betonte Eißing immer wieder deren hohen Denkmalwert. Diese sei über tausend Jahre durch das Wirtschaften der Benediktiner geprägt worden. Ihre Strukturen sind heute noch deutlich erkennbar an den Wegeführungen mit begleitenden Hecken, die zur Führung der Weidetiere dienten, die man zur Eichelmast in den Wald und auf die Wiesen trieb. Ehemalige Wein- und Hopfenfelder, die sich mit Streuobstwiesen abwechseln, bilden eine Mosaiklandschaft von höchster Qualität, die es zu bewahren gilt.
Kritische Worte fand die Stadtheimatpflegerin zur Bedrohung durch die immer weiter heranrückende Randbebauung, die sowohl im Stil als auch in ihren Dimensionen meist keine Rücksicht auf die angrenzende Natur- und Kulturlandschaft nimmt. So musste erst vor Kurzem ein Bebauungsplan an der Kettenstraße wegen völlig unangepasster Planung nach den Protesten denkmal- und naturschützender Vereine in die Neuplanung verwiesen werden. Es bleibt nur zu hoffen, dass Bauherren ihre Verpflichtung zu nachhaltiger Bauweise anerkennen, die die Denkmallandschaft nicht beschädigt. Eine klare Positionierung der Stadt durch die selbstverpflichtende Einführung einer Pufferzone für das Welterbe wäre hier ein erster Schritt.
Michael Rieger



Neueste Kommentare